Policy Holder? Warum bleiben wir nicht einfach bei «Versicherungsnehmer»?
17 Februar, 2025 | Aktuell Allgemein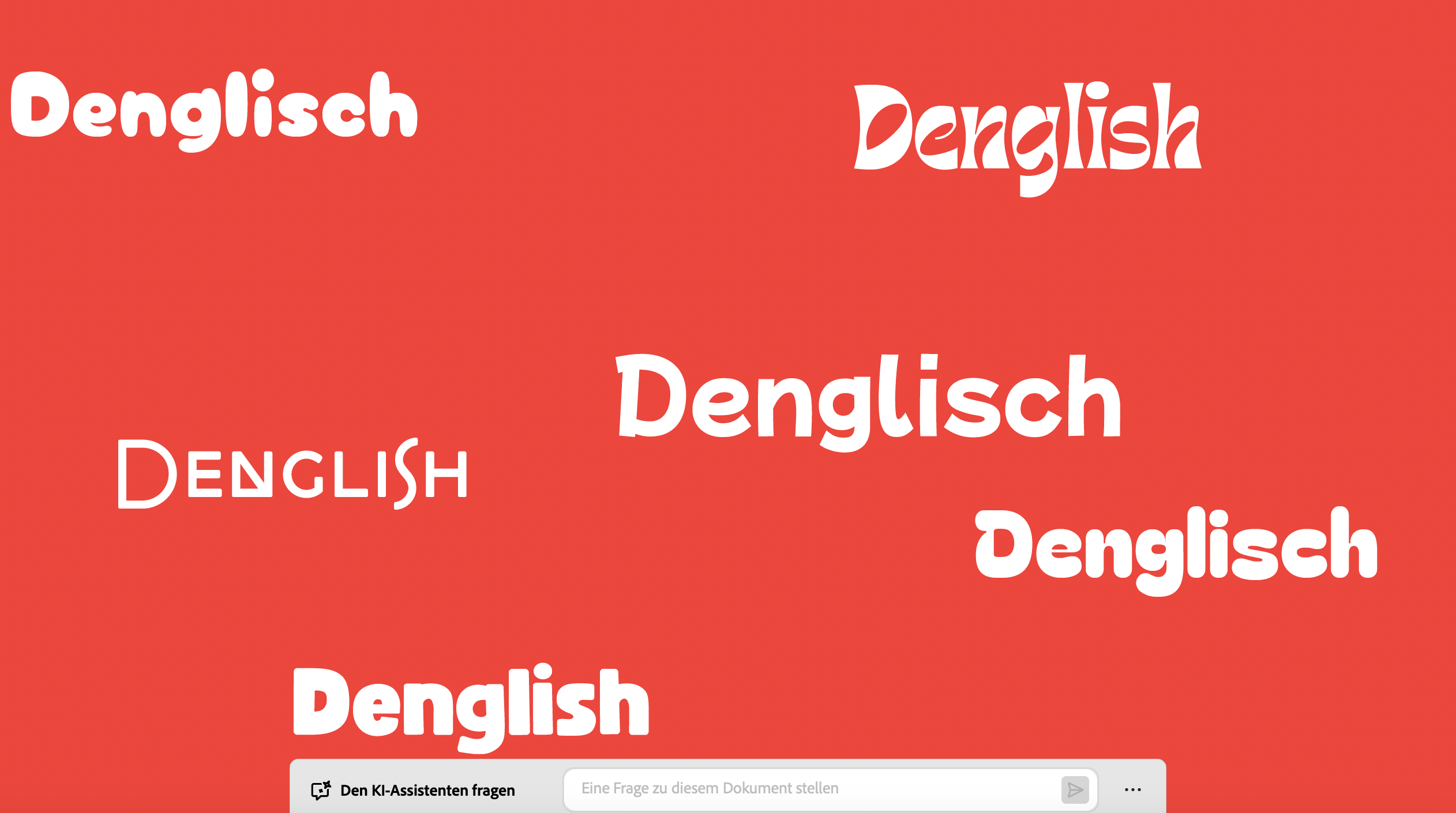
Die deutsche Sprache ist bekanntlich eine der präzisesten und ausdrucksstärksten der Welt. Doch in der Versicherungsbranche – zugegeben leider nicht nur dort – scheint sie langsam aber sicher von einer wilden Mischung aus Deutsch und Englisch, dem sogenannten «Denglisch», verdrängt zu werden. Warum sagen wir nicht mehr einfach «Versicherungsnehmer», sondern müssen stattdessen von «Policy Holdern» und «Claim Managern» sprechen? Und wieso fühlt sich jeder zweite Versicherungsvertrag an, als hätte man ihn mit Google Translate aus dem Englischen übersetzt, um etwas mehr gobalen Glanz zu erzeugen?
Warum einfach, wenn es doch complicated geht?
Denglisch: Die neue Lingua Franca der Versicherungen?
Es ist kein Geheimnis, dass die Sprache des Versicherungswesens schon lange mit zahlreichen Fachbegriffen gespickt ist, welche oft schon auf Deutsch schwer verständlich sind. Worte, die aus dem Angelsächsischen stammen und manchmal treffender bezeichnen, was eigentlich gemeint ist. Doch in den letzten Jahren hat sich ein neuer Trend durchgesetzt: Denglisch. Das ist die Kunst, unnötiger Weise deutsche Sätze mit englischen Begriffen zu schmücken, bis niemand mehr genau weiss, ob man gerade einen Versicherungsvertrag, oder die Bedienungsanleitung einer chinesischen Kartoffelreibe liest.
Statt von «Versicherungsnehmern» sprechen wir plötzlich von «Policy Holdern». Der «Schadenfall» wird zum «Claim», und die «Risikobewertung» verwandelt sich in ein «Risk Assessment». Selbst die «Versicherungsprämie» darf sich nicht mehr mit ihrem deutschen Namen zufriedengeben und wird kurzerhand zur «Premium» umgetauft. Aber warum? Ist «Versicherungsprämie» nicht gut genug? Nein, «Premium» klingt einfach cooler?
Ein möglicher Grund für den Denglisch-Boom in der Versicherungsbranche ist die Internationalisierung. Viele Versicherungsunternehmen agieren global und müssen sich an internationale Standards anpassen. Da kommt es gelegen, wenn man Begriffe verwendet, die weltweit verstanden werden – oder zumindest so klingen, als würden sie weltweit verstanden werden. Doch während die Branche versucht, sich international zu präsentieren, bleibt der Kunde im DACH-Raum oft ratlos zurück. Denn wer weiss schon, was ein «Underwriter» macht? (Spoiler: Es hat nichts mit Unterwäsche zu tun.)
Wenn Sie englische Anrufe dann noch über ihr Handy verabreden, tönt dies für den Geschäftspartner ohne germanischen Hintergrund, allenfalls cringe, dieses Wort für Ihr Mobiltelefon wurde in Deutschland frei erfunden, wie Homeoffice oder Oldtimer.
Frankreich: «Non merci» zu Anglizismen
Während in der Schweiz, Deutschland und Österreich das Denglisch fröhliche gefeiert wird, geht man in Frankreich einen ganz anderen Weg. Dort gibt es seit 1994 die «Loi Toubon», ein Gesetz, das die Verwendung der französischen Sprache in offiziellen Dokumenten und Verträgen vorschreibt. Das bedeutet: Versicherungsverträge müssen ausschliesslich auf Französisch verfasst sein, und englische Begriffe sind nur erlaubt, wenn es keine französische Entsprechung gibt – und selbst dann muss eine Übersetzung beigefügt werden. Ist das nicht ausnahmslos korrekt der Fall, sind Dokumente, Verträge und aufgepasst: auch Rechnungen ungültig.
Das Ergebnis? In Frankreich heisst der «Claim» einfach «Sinistre“» und die «Policy» wird zur «Police d’assurance». Aber nicht zur Versicherungspolizei. Klingt das weniger modern? Vielleicht. Aber es hat den Vorteil, dass jeder Franzose versteht, worum es geht. Und das ist doch letztendlich der Sinn eines Versicherungsvertrags? Oder will die Grande Nation ihre zugegeben schöne Sprache bloss mit bus pénitentiaires vor jeder Verunreinigung schützen?
Und was ist mit der Schweiz, Deutschland und Österreich?
In der Schweiz, Deutschland und Österreich gibt es keine vergleichbaren Gesetze wie die «Loi Toubon». Hierzulande darf jeder Versicherer seine Verträge so gestalten, wie er es für richtig hält – und das führt oft zu einer wilden Mischung aus Deutsch und Englisch. Doch während die Schweiz und Österreich eher zurückhaltend mit Anglizismen umgehen, scheint Deutschland ein echtes Paradies für Denglisch zu sein.
Die Grosszahl der Eidgenossen zieht das Englische dem Rätoromanischen klar vor, doch die Versicherungsbranche – welch Überraschung! – hält sich an die übrigen Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch.
In Österreich ist die Situation ähnlich. Hier wird zwar gerne mal ein englischer Begriff eingestreut, aber die meisten Versicherungsverträge bleiben doch eher traditionell, in einer Sprache, die Magister, Hofrat oder Professor in der Volksschule verwenden.
Deutschland hingegen – kehren wir noch einmal dorthin zurück – scheint ein besonderes Faible für Denglisch zu haben. Vielleicht liegt es daran, dass die Deutschen gerne alles ein bisschen internationaler, bedeutender klingen lassen wollen. Oder ist es der Versuch, die Versicherungsbranche vornehm aufzupeppen. Denn seien wir ehrlich: Wer will schon einen langweiligen Versicherungsvertrag lesen, wenn er stattdessen ein «Premium Policy Package» haben kann?
Cui bono? Der Vatikan hält nicht von Denglisch
Während in der Schweiz trefflich über Denglisch gestritten wird, verbietet sich der Vatikan, das kleinste Land der Welt, jede Verballhornung ihrer heiligen Sprache, dem alten Latein. Und das nicht nur in der Kirche, sondern auch in offiziellen Dokumenten. Nicht ganz einfach, wenn es um Gegenstände oder Dienstleistungen der Neuzeut geht. Die alten Römer kannten nun einmal weder Auto, noch Pistolen. Die Pontificia Academia Latinitatis (Päpstliche Akademie für Latein) ist deshalb dafür zuständig, neue lateinische Begriffe zu erfinden, Verzeihung zu erschaffen, um moderne Konzepte auszudrücken. So wird aus der «Versicherung» kurzerhand eine «assecuratio», und der «Versicherungsnehmer» wird zum «assecuratus» und zum Petersdom fährt sich am besten mit dem «autocinetum». Geht doch!
Klingt das altmodisch? Vielleicht. Aber wer braucht schon Denglisch, wenn er mit Latein glänzen kann?
Fazit: Denglisch – Fluch oder Segen?
Die Frage, ob Denglisch in der Versicherungsbranche ein Fluch oder ein Segen ist, lässt sich nicht so einfach beantworten. Auf der einen Seite kann die Verwendung englischer Begriffe dazu beitragen, sich international zu präsentieren und komplexe Sachverhalte präziser auszudrücken. Auf der anderen Seite führt es oft zu Verwirrung, Unverständnis und falsche Distanz bei den Kunden, die sich fragen, warum sie plötzlich eine «Policy» statt eines Versicherungsvertrags haben.
Vielleicht wäre es an der Zeit, einen Mittelweg zu finden: Ein bisschen Englisch ist okay, aber nitte nicht auf Kosten der Verständlichkeit. Und falls wir und doch nicht von unserem geliebten Denglisch trennen können, sollten wir zumindest sicherstellen, dass wir die Begriffe richtig verwenden. Denn nichts ist peinlicher, als einen «Topsharing»-Vertrag anzubieten, nur um später festzustellen, dass das im Englischen eher nach dem Teilen von Oberbekleidung klingt.
Binci Heeb
Lesen Sie auch einen Artikel, dessen Protagonist sich der englischen und französischen Sprache bedient: InsurAngels Suisse: Ein gemeinnütziger Verein für die Versicherungswirtschaft




